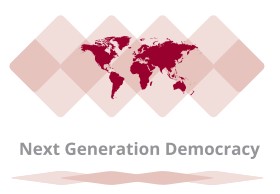Beitrag für das Debattenmagazin “
The European“, 17.4.2014
Die Europäische Union hat ihre von Zahlungsunfähigkeit bedrohten Mitgliedstaaten erfolgreich stabilisiert. Sie errichtete einen Europäischen Stabilitätsmechanismus, der gefährdeten Mitgliedstaaten des Euro-Währungsraums umfangreiche Kredite gewährt, wenn diese sich zur Umsetzung von Wirtschaftsreformen verpflichten. Die Europäische Zentralbank erklärte ihre Bereitschaft, kurzfristige Anleihen von Staaten anzukaufen, die den Stabilitätsmechanismus in Anspruch nehmen. Damit konnte die EU die Finanzmärkte davon überzeugen, dass die gesamte Eurozone den Ausfall von Krediten an einzelne Mitgliedstaaten mit Zahlungsproblemen verhindern wird.
Mit diesen Beschlüssen bürgten Deutschland und andere finanzielle stabile Eurostaaten für die gefährdeten Staaten und demonstrierten so ihre Solidarität. Umgekehrt verpflichteten sich die Krisenstaaten, ihre Finanz- und Wirtschaftspolitik am Stabilitätsziel zu orientieren und den Mitgliedstaaten der Eurozone sowie den EU-Institutionen ein Mitentscheidungsrecht über diese Politiken einzuräumen. Sie verringerten dadurch das Risiko, ökonomisch unverantwortlich zu handeln und die gesamte Eurozone destabilisieren.
Bei der Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise verhielten sich insofern nicht nur die finanziell stabilen Eurostaaten solidarisch, und deren Haftungsbereitschaft entsprach ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse an der Vermeidung von Ansteckungseffekten. Dies zeigt, dass Solidarität sich nicht auf uneigennützige Hilfe beschränkt, sondern unter den EU-Mitgliedstaaten angemessener als Investition in gemeinschaftliche Handlungsfähigkeit verstanden werden sollte, die mittelbar und indirekt auch den Hilfeleistenden selbst nützt.
Es ist jedoch ungewiss, ob die zwischenstaatliche Solidarität aufrechterhalten und vertieft werden kann, solange die EU nicht in einer europäischen Gesellschaft mit einer gemeinsamen, nationenübergreifenden Identität wurzelt. Mit der Eurozonenkrise hat sich die Kluft zwischen ökonomisch-politischer und identitär-gesellschaftlicher Integration vertieft.
Die von der EU mit verordneten Sparprogramme für krisenbetroffene Eurostaaten erschütterten deren nationalen Wirtschafts- und Sozialordnungen und kündigten die darin repräsentierten Kompromisse zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen auf. Begründet wurden diese Eingriffe damit, dass Eurostaaten die makroökonomischen Ungleichgewichte nur abbauen können, wenn sie ihre Staatshaushalte konsolidieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen Eurostaaten wiederherstellen. Aber die meisten Bürger wussten nichts über die weitreichenden Konsequenzen solcher interner Abwertungen, als sie dem Beitritt zur Währungsunion zustimmten.
Gegenüber den wirtschaftlich schwächeren Mitgliedstaaten konnte die EU ihre Wohlstandsperspektive nur teilweise realisieren. Wenn man die Entwicklung des Prokopf-Bruttoinlandsprodukts in Kaufkraftparitäten vom Zeitpunkt der EU-Osterweiterung 2004 bis 2012 vergleicht, ergibt sich ein ernüchterndes Bild. Polen, die Slowakei, die baltischen Staaten sowie Bulgarien und Rumänien konnten ihr in dieser Kennziffer ausgedrücktes Wohlstandsniveau so erhöhen, dass sich der Abstand zum Durchschnitt der 28 EU-Staaten verringerte. Dieser Aufholprozess erfolgte jedoch nur sehr langsam. Falls etwa Polen seine durchschnittliche jährliche Konvergenzrate aus diesem Zeitraum beibehalten kann, dann erreicht es den EU-Durchschnitt erst nach 2040. Tschechien, Ungarn und Slowenien fielen seit ihrer EU-Mitgliedschaft gegenüber dem EU-Durchschnitt zurück, und Griechenland sowie Portugal verarmten sogar in absoluten Zahlen.
Die Wirtschafts- und Finanzkrise offenbarte die Auslandsabhängigkeit dieser Staaten und nährte die Zweifel am Versprechen der pro-europäischen Parteien, dass die ökonomische Integration mittel- und langfristig Wohlstandsgewinne erzeugen würde. Enttäuschte Erwartungen veranlassten viele Bürger/-innen dazu, euroskeptische oder -feindliche Protestparteien zu wählen. Rechtspopulistische Protestparteien erhielten aber auch in Frankreich und anderen EU-Mitgliedstaaten Zulauf, die während der Eurokrise nicht in akute Finanznot geraten waren. Zunehmende soziale Ungleichheit und geringere soziale Mobilitätschancen, Beschäftigungsunsicherheit sowie die perzipierte Konkurrenz durch Zuwanderer führten hier dazu, dass insbesondere Bevölkerungsgruppen mit geringem Bildungsniveau die europäische Integration als diffuse Bedrohung empfanden und vermeintliche Alternativen wählten. Auch wenn die Europakritiker keine nationalen Regierungsmehrheiten erreichen, schränken sie die Spielräume gemeinschaftlichen Handelns in der EU ein.
Wie kann die EU in dieser Lage ihre Solidaritätsbasis stärken? Sie müsste einerseits mehr tun, um die sozioökonomische Konvergenz der ärmeren Mitgliedstaaten zu fördern. Die unterschiedlichen Fortschritte in dieser Gruppe – z.B. zwischen Polen und Ungarn – weisen darauf hin, dass eine gute Regierungsführung offenbar Einfluss auf die langfristige Wachstumsdynamik hat. Hier könnten transnationale Vergleiche und Erfahrungstransfers mehr Transparenz, öffentliche Kontrolle und Lernen bewirken.
Andererseits müsste sie Befürchtungen begegnen, die die Integration mit der Erosion nationaler Sozialmodelle verbinden. In der Debatte um die soziale Dimension der Währungsunion schlug die Europäische Kommission im Oktober 2013 einen Fonds vor, der Eurostaaten bei Konjunkturschwankungen und kurzfristigen Ungleichgewichten unterstützt und dessen Transfers an die relativen Wachstumsdefizite gegenüber dem Eurozonendurchschnitt oder an eine bestimmte Arbeitslosenquote gekoppelt werden könnten. Darüber hinaus sollte den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, ihre nationalen Sozialmodelle gegen den Abbau von Leistungsstandards im Unterbietungswettbewerb mit anderen Mitgliedstaaten zu schützen. Die EU könnte zum Beispiel Mindestniveaus für öffentliche Sozialausgaben in Abhängigkeit vom ökonomischen Leistungsniveau festlegen. Ökonomische Konvergenz würde damit auch eine Konvergenz der Ausgabenniveaus bedeuten.